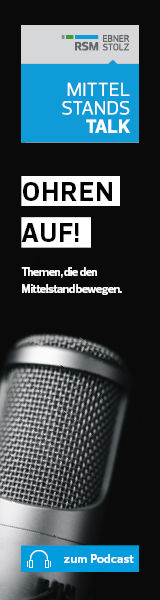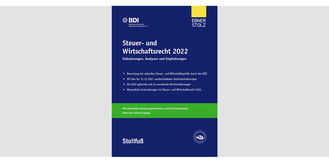Der überwiegende Teil der Änderungen tritt zum 01.07.2023 in Kraft; das Stiftungsregister mit negativer Publizitätswirkung soll dann - wie erwartet - zum 01.01.2026 umgesetzt werden.
 © unsplash
© unsplashEntstehung von Stiftungen und mutmaßlicher Stifterwille
Während in vorangegangenen Entwürfen noch auf die „Errichtungssatzung“ als ein eigenes Rechtsinstitut abstellte, das für die Stiftung als maßgeblich angesehen wurde, kehrt das Gesetz nun wieder zu dem bisherigen, offeneren Begriff der Satzung zurück. Damit ist auch wieder der mutmaßliche Stifterwille als Auslegungsmaßstab zugelassen, auch wenn nach wie vor dem im Zeitpunkt der Stiftungserrichtung niedergelegten Willen eine besondere Bedeutung zukommt. Ergänzend ist der mutmaßliche Stifterwille unter Berücksichtigung wesentlicher nachfolgender Veränderungen heranzuziehen. Die Begrenzung auf den historische Stifterwillen, wie er aus dem Stiftungsgeschäft einschließlich der (Errichtungs-)Satzung ermittelt werden kann, wurde insb. deshalb kritisiert, weil Stiftungsgeschäft und Satzung möglicherweise nicht alle Motive des Stifters abbilden oder der historische Stifterwille zu einem konkreten Fall später gar nicht ermittelt werden kann.
Hinweis: Der mutmaßliche Stifterwille kann sich auch aus anderen, außerhalb der Satzung liegenden Quellen ergeben. Unverändert bleibt es jedoch dabei, dass es auf den tatsächlichen oder mutmaßlichen Willen des Stifters im Zeitpunkt der Errichtung der Stiftung ankommt. Nachträgliche Motivänderungen sind dem Stiftungsrecht nach wie vor fremd.
Stiftungsregister
Das ab 01.01.2026 zu führende neue Stiftungsregister soll eine den Kapitalgesellschaften oder Vereinen entsprechende Publizität entfalten. Es vermittelt allerdings (nur) negative Publizität. Das bedeutet, dass eine einzutragende Tatsache gegenüber einem Dritten nur gilt, wenn sie eingetragen ist oder der Dritte sie kennen musste; ist sie eingetragen, kann sie einem Dritten entgegengehalten werden, es sei denn, der Dritte kannte die Tatsache nicht und musste sie auch nicht kennen.
Die Einsichtnahme in das Register und in die dort veröffentlichten Dokumente ist durch jedermann ohne Darlegung eines besonderen Interesses möglich, sie ist aber eingeschränkt, wenn die Stiftung oder ein Dritter ein berechtigtes Interesse daran haben, bestimmte Inhalte nicht offen zu legen, wie z. B. die personenbezogenen Daten von Destinatären oder höchstpersönliche Inhalte in Satzungen. Gerade für Familienstiftungen, aber auch für Stiftungen mit einem besonderen Unternehmensbezug in der Satzung, ist diese Einschränkung von besonderer Bedeutung.
Stiftungsvermögen und Umschichtungsgewinne
Die Regelungen, wie sie aus dem Kabinettsentwurf bekannt waren, wurden übernommen. Die Aufteilung in Grundstockvermögen und sonstiges Vermögen bleibt erhalten. Zum Grundstockvermögen gehören das der Stiftung bei der Errichtung gewidmete Vermögen, spätere Zustiftungen in das Grundstockvermögen sowie Vermögen, das von der Stiftung zu Grundstockvermögen bestimmt wird. Daneben gibt es sonstiges Vermögen, das nicht dem Grundsatz der Kapitalerhaltung unterliegt. Wie es bereits gängige Praxis ist, wurde nunmehr im Gesetz auch die bereits etablierte sog. Hybridstiftung geregelt. Hierbei handelt es sich um eine Ewigkeitsstiftung, bei der ein verbrauchbares Teilvermögen besteht.
Der Grundsatz der Erhaltung des Grundstockvermögens, der sich bisher in durchaus unterschiedlicher Ausprägung in den Landesstiftungsgesetzen findet, wird in das einheitliche Stiftungszivilrecht im bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) aufgenommen. Es bleibt jedoch dabei, dass gesetzlich nicht näher konkretisiert wird, ob ein realer oder nominaler Kapitalerhalt verlangt wird. Gegenständlicher Kapitalerhalt kann u. E. nur dann verlangt werden, wenn der Stifter oder Zustifter dies bei der Zuwendung ausdrücklich bestimmt oder wenn der Vermögensgegenstand notwendigerweise im Stiftungsvermögen verbleiben muss. Dies ist der Fall, wenn der Zweck der Stiftung hierauf gerichtet ist. Im Übrigen ist für die Frage des realen oder nominalen Kapitalerhalts - wie bisher auch - der Stifterwille zum Zeitpunkt der Errichtung der Stiftung maßgeblich. Bei Neuerrichtungen empfiehlt es sich daher, das Kapitalerhaltungskonzept zumindest in Grundzügen in der Satzung zu regeln.
Hinweis: Gerade in der aktuellen Niedrigzinsphase wird es insb. Kapitalstiftungen nur sehr schwer möglich sein, realen Kapitalerhalt umzusetzen. Gleichwohl haben die Stiftungsbehörden bei Neuerrichtungen die Tendenz, den Stiftungen realen Kapitalerhalt „in die Satzung schreiben“ zu wollen. Hier ist Vorsicht geboten. Wenn der Gesetzgeber auf eine Festlegung verzichtet hat, lässt sich daraus ableiten, dass er dem Stifter offensichtlich eine gewisse Freiheit zubilligt. Ob natürlich auf Dauer nominaler Kapitalerhalt sinnvoll ist, kann dahingestellt bleiben, denn es steht der Stiftung natürlich frei, nach Möglichkeit realen Kapitalerhalt anzustreben. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Stiftung sich hierauf von vornherein festlegen muss. Am Ende müssen die Stiftungsorgane in der Lage sein, nach pflichtgemäßem Ermessen zu entscheiden, welche Art und Weise der Vermögenserhaltung den Erfordernissen der Stiftung und der Verwirklichung der Zwecke entspricht.
Im Vorfeld des Gesetzesbeschlusses hatte das sog. Surrogationsprinzip für Besorgnis insbesondere bei Bestandsstiftungen geführt. Danach sollte alles zu Grundstockvermögen werden, was die Stiftung als Ersatz oder durch Rechtsgeschäft mit Mitteln des Grundstockvermögens erwirbt. Dies hätte bedeutet, dass Umschichtungsgewinne nicht zur Verwendung für satzungsmäßige Zwecke zur Verfügung stünden, sondern dem Grundstockvermögen zuzuschlagen gewesen wären. Bisher war es zwar durchaus Gegenstand von systematischen Diskussionen, jedoch grundsätzlich möglich, Umschichtungsgewinne zu verwenden. Dies sollte nach bisheriger Praxis auch ohne ausdrückliche Satzungsregelung gelten (strittig). Gerade bei Bestandsstiftungen fehlen solche Regelungen häufig.
Nach den ursprünglichen Gesetzentwürfen sollte eine Verwendung der Umschichtungsgewinne nur aufgrund ausdrücklicher Satzungsregelung erlaubt sein. Beschlossen wurde nun eine entgegengesetzte Regelung: der Verbrauch der Umschichtungsgewinne ist grundsätzlich möglich, es sei denn, dies ist durch die Satzung ausdrücklich ausgeschlossen.
Vorstands- und Organhaftung
Das neue Stiftungszivilrecht verzichtet für den Vorstand weitgehend auf Verweise ins Vereinsrecht und schafft eigenständige stiftungsrechtliche Regelung mit Verweis auf das Auftragsrecht. Sehr positiv ist die Einführung einer stiftungsrechtlichen Business Judgement Rule.
Ein Organmitglied, das seine Pflichten schuldhaft verletzt, ist der Stiftung nun aufgrund einer eigenen Haftungsnorm zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Entgegen den vorangegangenen Entwürfen bleibt es bei der Beweislastregelung der allgemeinen Haftungsregelungen, d. h. dem Schuldner obliegt der Entlastungsbeweis.
Statusänderungen/Änderung der Satzung
Kernpunkt der Reform ist die bundeseinheitliche Regelung des Stiftungszivilrechts. Bislang regelten die Landesstiftungsgesetze höchst unterschiedlich die Frage der Satzungsänderung. Der gesamte „Lebenszyklus“ der Stiftung wird jetzt im BGB geregelt. Dort sind auch die Verfahrensregelungen zentral erfasst.
Es gilt ein Konzept der dreistufigen Satzungsänderung mit dem Grundsatz: je stärker der Eingriff in das Wesen der Stiftung, desto strenger die Voraussetzungen.
Eine einfache Satzungsänderung ist zukünftig möglich, wenn durch die Änderung die Zweckverwirklichung erleichtert wird; eine Änderung der Verhältnisse ist nicht erforderlich. Eine Änderung prägender Vorschriften wird möglich bei einer wesentlichen Änderung der Verhältnisse und wenn die Satzungsänderung für die Anpassung an die geänderten Verhältnisse erforderlich ist. Zweckänderung oder Zweckbeschränkung können nur beschlossen werden, wenn der Stiftungszweck nicht mehr dauernd und nachhaltig erfüllt werden kann, wobei die endgültige Unmöglichkeit nicht mehr gefordert ist, Darüber hinaus können Zweckänderung oder Zweckbeschränkung nur beschlossen werden, wenn der Zweck der Stiftung das Gemeinwohl gefährdet. Auch die Umwandlung einer notleidenden Ewigkeitsstiftung in eine Verbrauchsstiftung ist jetzt ausdrücklich geregelt.
Hinweis: Nach wie vor wird die Art und Weise der Zweckerfüllung als prägend für die Stiftung angesehen. Dies wird kritisiert, weil zwar der Stiftungszweck selbstverständlich prägend ist, jedoch nicht die Maßnahmen zur Umsetzung und Erreichung. Diese werden sich vielfach im Laufe des Lebens einer Stiftung situativ ändern, die Satzungsregelungen hierzu sind aber nur unter erschwerten Bedingungen änderbar.
Die Regelungen zur Satzungsänderung sind dispositiv, der Stifter kann Satzungsänderungen ausschließen, begrenzen oder die Voraussetzungen erleichtern. Die Satzung kann auch dem Vorstand oder einem anderen Organ die Änderungskompetenz zuweisen. Nach wie vor unzulässig ist aber eine Pauschalermächtigung an die Stiftungsorgane. Der Stifter muss Leitlinien oder Orientierungspunkte für die Satzungsänderungen in der Satzung festschreiben
Hinweis: Die erleichterten Möglichkeiten zur Satzungsänderung stellt insb. Bestandsstiftungen, die unter einem strengeren Regime errichtet wurden, vor eine Herausforderung. Es empfiehlt sich, die Satzungen zu überprüfen, ob Anpassungen an die Neuregelungen bereits jetzt erfolgen sollten. Die Legitimation für die Satzungsänderung liegt darin, dass davon auszugehen ist, dass der Stifter, hätte er bei Errichtung die Gesetzesänderung und insbesondere die erleichterten gesetzlichen Voraussetzungen zur Veränderbarkeit der Stiftungssatzung bereits vorausgesehen, diese in der Satzung angelegt hätte. Eine solche Änderung sollte vor Inkrafttreten am 01.07.2023 auf Basis der aktuellen noch anwendbaren Landesstiftungsgesetze herbeigeführt werden, denn das Gesetz lässt Erleichterungen der Änderungsvoraussetzung nur im Stiftungsgeschäft zu. Daher könnte nach dem Inkrafttreten eine solche Änderung nicht mehr möglich sein. Findet sich jedoch zu diesem Zeitpunkt eine ausdrückliche Regelung in der Satzung, genießt diese bei Inkrafttreten des Gesetzes wohl Bestandsschutz.
Auflösung oder Aufhebung der Stiftung
Zukünftig ist sowohl die Auflösung der Stiftung durch die Stiftungsorgane wie auch die Aufhebung durch die Stiftungsbehörde zulässig. Bisher kannte das Bundesgesetz nur die behördliche Aufhebung, während eine Auflösung durch Organbeschluss unterschiedlich in den Landesstiftungsgesetzen geregelt war.
Ausblick und Kritik
Auch wenn der Gesetzgeber Stiftern zukünftig einen weiteren Gestaltungsspielraum einräumt als bisher, ist es nach wie vor lebenden Stiftern nicht möglich - wenigstens in der ersten Zeit nach der Stiftungserrichtung - erforderliche Zweckanpassungen vorzunehmen. Auch das vielfach geforderte Satzungsänderungsrecht des lebenden Stifters findet sich nicht im Reformgesetz. Stiftern ist es nach wie vor nur dann möglich, Satzungsänderungen anzustoßen, wenn sie Mitglied eines hierzu ermächtigten Organs sind.
In der Satzung einer Verbrauchsstiftung ist auch nach der Reform ein Verbrauchszeitraum anzugeben; nach Ablauf dieses Verbrauchszeitraums ist die Stiftung zwingend aufzulösen. Hier wäre eine Flexibilisierung im Sinne einer Prolongation der Stiftungsdauer wünschenswert gewesen.
Nach wie vor unbeantwortet bleibt die Frage, ob die Führung des neuen Stiftungsregisters durch das Bundesamt für Justiz wirklich verfassungsrechtlich zulässig ist. Eine Verortung des Stiftungsregisters bei den Amtsgerichten in Ankopplung an die Vereinsregister und damit innerhalb der Justizhoheit der Länder wird vielfach nicht nur als zulässig, sondern auch als naheliegend und darüber hinaus praktikabler angesehen.
Trotz aller Kritik: Eine Modernisierung und Vereinheitlichung des Stiftungszivilrechts war überfällig. Es führt zu mehr Rechtssicherheit im Stiftungszivilrecht, weil alle Stiftungen zukünftig einheitlichen Regelungen unterliegen. Bereits jetzt sollten die beschlossenen Regeln sowohl bei Satzungsentwürfen für neu zu errichtende Stiftungen aber auch bei der Überprüfung bereits bestehender Stiftungen berücksichtigt werden. Denn Stiftungen haben nach der Reform mehr Gestaltungsmöglichkeiten für ihre Weiterentwicklung.