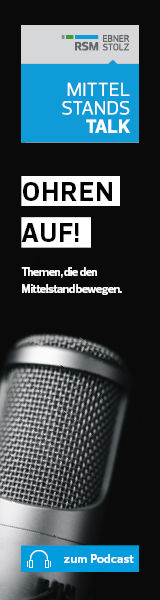Wir sprechen mit Bernhard Steffan, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Partner bei Ebner Stolz in Stuttgart und Vorsitzer des Fachausschusses Sanierung und Insolvenz des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW FAS), welche Kriterien erfüllt werden müssen, um an staatliche Unterstützungsleistungen zu erhalten.
 © Bernhard Steffan, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Partner bei Ebner Stolz
© Bernhard Steffan, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Partner bei Ebner StolzHerr Steffan, welche sind die wesentlichen Maßnahmen, die umgesetzt wurden, um Unternehmen in dieser wirtschaftlich prekären Situation unter die Arme zu greifen?
Der Gesetzgeber hat mit dem sog. Corona-Insolvenz-Aussetzungsgesetzes (CORInsAG) in noch nie dagewesener Geschwindigkeit die rechtlichen Rahmenbedingungen und darauf aufbauend zahlreiche nachfolgende wirtschaftliche Unterstützungsmaßnahmen für die Unternehmen, die sich aufgrund der Corona-Krise in einer wirtschaftlichen Notlage befinden, auf den Weg gebracht.
Die wesentlichen Rahmenbedingungen waren zum einen die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht zunächst bis zum 30.9.2020, damit die Unternehmen, die aufgrund der Corona-Krise ihren Zahlungsverpflichtungen temporär nicht mehr nachkommen können, nicht in die Insolvenz rutschen und damit vom Markt verschwinden. Zum anderen wurde die Haftung für Zahlungsverbote ausgesetzt, damit Geschäftsführer im Falle der Insolvenzreife der Gesellschaft nicht in die persönliche Haftung geraten. Und schließlich wurde die Insolvenzanfechtung ausgesetzt, damit Liquiditätshilfen auch rechtssicher von Dritter Seite gegeben werden können.
Um die von der Corona-Krise betroffenen Unternehmen auf der Ausgabenseite zu entlasten, wurden parallel die Voraussetzungen für liquiditätsschonende Maßnahmen wie bspw. die Stundung von Mietzahlungen und Steuer- und Sozialversicherungsbeiträgen geschaffen. Daran schließen sich insb. die Liquiditätshilfen der KfW an.
Um diese Maßnahmen in Anspruch nehmen zu können, müssen die betroffenen Unternehmen bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Welche sind dies konkret?
Um von der Insolvenzantragspflicht entbunden zu sein, muss die Insolvenzreife auf die Auswirkungen der Corona-Krise zurückzuführen sein und es muss die Aussicht bestehen, einen danach eingetretenen Insolvenzgrund zu beseitigen. Da es in der Praxis schwierig sein kann nachzuweisen, ob ein Insolvenzantragsgrund auf den Auswirkungen der Corona-Krise beruht, arbeitet der Gesetzgeber zu Gunsten der Unternehmen mit einer Vermutungsregelung. Es wird grundsätzlich gesetzlich vermutet, dass bei bestehender Zahlungsfähigkeit zum 31.12.2019, die spätere Insolvenzreife auf der Corona-Krise beruht und Aussichten bestanden, eine bestehende Zahlungsunfähigkeit zu beseitigen. Dadurch sollen Unternehmen mit einem gesunden Geschäftsmodell, bei denen bis Ende letzten Jahres keine Krisenanzeichen zu erkennen waren, weiter fortgeführt werden.
Kann dann also pauschal von einer Fortführungsfähigkeit des Unternehmens ausgegangen werden, wenn zum 31.12.2019 Zahlungsfähigkeit bestand?
Zunächst einmal ja. Kommt es allerdings später - trotz Aussetzung der Antragspflicht – zu einem Insolvenzverfahren, wird ein Insolvenzverwalter Ansprüche wegen einer verspäteten Antragstellung prüfen und wenn gegeben, auch verfolgen. Der Geschäftsführer trägt dann die Beweislast dafür, dass keine Antragspflicht vorlag, da der Insolvenzgrund auf den Auswirkungen der Corona-Epidemie beruhte und begründete Aussichten bestanden die Krise unter Einbeziehung der staatlichen Hilfsmaßnahmen zu meistern. Gelingt der Entlastungsbeweis nicht, kann dies u. a. dazu führen, dass die Geschäftsleiter auf Erstattung sämtlicher nach Eintritt der Insolvenzreife vom Unternehmen noch geleisteter Zahlungen persönlich in Anspruch genommen werden.
Vor diesem Hintergrund sollte die Geschäftsführung dringend die Liquiditätsplanung vor Eintritt der Corona-Krise mit dem Nachweis dokumentieren, dass weder Zahlungsunfähigkeit noch Überschuldung vorlagen. Zudem sollte die Liquiditätsplanung mit den Auswirkungen der Corona-Krise erstellt werden. Der Vergleich beider Planungen ergibt den durch die Corona-Krise ausgelösten zusätzlichen Liquiditätsbedarf. Schließlich sollten die beantragten öffentlichen Hilfen bzw. die ernsthaften Finanzierungsverhandlungen dokumentiert werden.
Für die Einschätzung der Fähigkeit, ein Unternehmen fortführen zu können, kommt es auch darauf an, dass ein Unternehmen ausreichenden Zugang zu Liquidität hat. Unter welchen Voraussetzungen können Unternehmen die zur Verfügung gestellten Hilfskredite der KfW oder der Bürgschaftsbanken in Anspruch nehmen?
Das KfW-Sonderprogramm 2020 steht ab dem 23.3.2020 auch Unternehmen zur Verfügung, die bedingt durch die Corona-Krise vorübergehend Finanzierungsschwierigkeiten haben, jedoch strukturell gesund und langfristig wettbewerbsfähig sind.
Um die Hilfskredite in Anspruch nehmen zu können, sind, wie ich bereits ausgeführt habe, zwei Liquiditätspläne bzw. Ertragsplanungen erforderlich - eine Planung vor und eine nach Eintritt der Corona-Krise. Hierdurch können dann die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Ertragslage und Liquidität des Unternehmens nachgewiesen und der erforderliche Kreditbetrag festgestellt werden.
Die KfW hat die Bedingungen für die Gewährung von Hilfskrediten mehrfach angepasst, zuletzt in den jeweiligen Merkblättern zum Unternehmer- und Schnellkredit, jeweils mit Stand vom 15.4.2020.
Danach darf es sich bspw. bei Inanspruchnahme des Unternehmerkredits zum Stand 31.12.2019 nicht um ein Unternehmen in wirtschaftlichen Schwierigkeiten handeln. Dies ist der Fall, wenn mindestens eine der folgenden Voraussetzungen nicht erfüllt ist:
- Es ist ein Verlust von mehr als der Hälfte des Haftkapitals zu verzeichnen.
- Das Unternehmen ist Gegenstand eines lnsolvenzverfahrens oder es liegt ein Insolvenzgrund vor.
- Das Unternehmen hat eine Rettungs- oder Umstrukturierungsbeihilfe der EU erhalten.
- In den vergangenen beiden Jahren lag
- der buchwertbasierte Verschuldungsgrad über 7,5 und
- das Verhältnis von EBITDA zu den Zinsaufwendungen unter 1,0.
Daneben darf die Hausbank keine Kenntnis von
- ungeregelten Zahlungsrückständen des Antragstellers von mehr als 30 Tagen haben,
- Stundungsvereinbarungen, die auf bonitätsbedingte Tilgungsaussetzungen zurückzuführen sind und deshalb dem Verlust der Kreditwürdigkeit gleichbedeutend sind, sowie
- materiellen Covenantbrüchen, die dem Verlust der Kreditwürdigkeit gleichbedeutend sind (z. B. Covenant Debt Service Coverage Ratio > 100 %).
Eine weitere Möglichkeit, die Unternehmensliquidität zu schonen, besteht darin, die Stundung von Steuerzahlungen sowie Sozialversicherungsbeiträgen zu beantragen.
Das ist richtig. Hier muss der Geschäftsführer aber Vorsicht walten lassen. Unter Umständen trifft den Geschäftsführer nämlich eine persönliche Haftung, wenn er die in Anspruch genommenen Steuervergünstigungen später nicht zurückzahlen kann. Diese Gefahr besteht nur dann nicht, wenn er nachweisen kann, dass die wirtschaftliche Notlage der Gesellschaft auf die Corona-Pandemie zurückzuführen ist. Anders wie bei der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht besteht hier keine Vermutungsregelung, wonach die wirtschaftliche Notlage ab einem bestimmten Stichtag als auf der Corona-Krise beruhend angesehen wird. Geschäftsführern ist deshalb dringend anzuraten, im Zuge der Beantragung entsprechender Stundungen die Corona-Bedingtheit genauestens zu dokumentieren und gegenüber den Behörden offenzulegen. Durch die beiden oben beschriebenen Planungen vor und nach der Corona-Krise kann dies belegt werden.