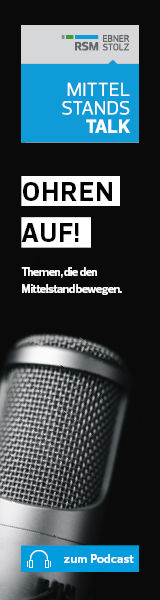Nach § 1 Abs. 1 Satz 1 StaRUG sind die Geschäftsleiter zur Überwachung von Entwicklungen verpflichtet, die zur Bestandsgefährdung des Unternehmens führen können. Diese Pflichten zur Krisenfrüherkennung sollten sich auf einen Zeitraum von 24 Monaten erstrecken. Der konkrete Umfang dieser Pflicht ist von der Größe, Branche, Struktur und auch der Rechtsform des jeweiligen Unternehmens abhängig, wobei in der Begründung des Regierungsentwurfs betont wird, dass überschaubare Verhältnisse bei kleinen Unternehmen nicht zu einer Überfrachtung der Risikoüberwachungsanforderungen führen dürfen.
 © unsplash
© unsplashLiquiditätsplanung als Bestandteil eines Risikoüberwachungssystems
Demzufolge muss das Risikoüberwachungssystem der Komplexität des Geschäftsmodells bzw. der Unternehmensstrukturen ausreichend Rechnung tragen. Geeignet ist ein solches System nach der Gesetzesbegründung zumindest dann, wenn es hilft, eine Insolvenz des Unternehmens zu vermeiden, oder eine frühe Verfahrenseinleitung zu ermöglichen.
Kein Muster für Liquiditätsplanung vom Bundesjustizministerium - aber Hinweis auf Ebner Stolz Veröffentlichung
KMUs sind damit ebenso verpflichtet, Risiken zu identifizieren und auch mit Blick auf die Liquidität zu bewerten und deren zeitlichen Eintritt abzuschätzen. Damit ist auch bei KMUs die Erstellung einer dem Unternehmen angemessenen Planungsrechnung verpflichtend. Von Seiten des Bundesministeriums für Justiz (BMJ) wird es jedoch entgegen der ursprünglichen Planung keine Hilfestellung für die Liquiditätsplanung für KMU geben, wie der 2. Ausgabe 2022 des INDat-Report auf S. 9 zu entnehmen ist. Das BMJ kam demnach zu dem Schluss, dass sich die Bereitstellung eines Musters für die Liquiditätsplanung nicht empfehle. Stattdessen wird auf Angebote fachkundiger Stellen und von Berufsträgern verwiesen. Denn, so das BMJ, müsse eine Liquiditätsplanung stets den Besonderheiten des planenden Unternehmens Rechnung tragen. Das Zahlenwerk der Liquiditätsplanung könne äußerst komplex sein und viele Faktoren berücksichtigen. Dazu wird vom BMJ explizit auf einen Aufsatz von Bernhard Steffan, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Janina Poppe, Steuerberaterin, Wirtschaftsprüferin, beide Partner sowie Jonathan Roller, Senior Consultant bei Ebner Stolz in Stuttgart (INDat-Report 09/2021, S. 52 ff.) verwiesen.
Überwiegend wahrscheinliche Liquiditätsentwicklung
Demnach muss die Liquiditätsplanung die überwiegend wahrscheinliche Liquiditätsentwicklung in den jeweils kommenden 24 Monaten abbilden. Dabei ist jeder Liquiditätsplanung immanent, dass die zugrunde gelegten Annahmen aufgrund nicht vorhersehbarer Umstände nicht eintreten oder anders ausfallen können. Mit zunehmender zeitlicher Entfernung der prognostizierten Ereignisse oder Annahmen vom Beurteilungsstichtag steigt zusätzlich der Grad der Unsicherheit und sinkt der Detaillierungsgrad der Annahmen.
Im Hinblick auf diese Unsicherheit ist zu beachten, dass die der Liquiditätsplanung zugrunde gelegten Annahmen plausibel, d. h. nachvollziehbar, konsistent und frei von Widersprüchen sein müssen. Zuflüsse aus den geplanten Umsatzgeschäften sind ebenso zu berücksichtigen wie sonstige zahlungswirksame Vorgänge. Hierzu zählen etwa Kapitalbeschaffungsmaßnahmen durch Fremdkapitalaufnahme (z. B. Kreditaufnahme) oder Zuführungen von Gesellschaftern. Dies gilt auch für weitere sinnvolle Finanzierungsmaßnahmen, wie Sale-and-Lease-Back-Geschäfte, Factoring oder den Verkauf von Teilen des nicht betriebsnotwendigen Vermögens. Auch sind die zahlungswirksamen Effekte aus finanz- oder leistungswirtschaftlichen Maßnahmen zu berücksichtigen.
Eine sachgerecht erstellte Planung auf der Basis plausibler Annahmen, in der bestehende und künftige Risiken sowie ggf. erforderliche Gegenmaßnahmen bewertet und eingepreist wurden, verbunden mit einem laufenden Soll-Ist-Vergleich, dokumentiert, dass den Anforderungen des § 1 StaRUG ausreichend Rechnung getragen wurde.
Regelmäßig kommt es auf die Sicht der gesetzlichen Vertreter auf Basis einer sog. ex-ante-Betrachtung (Betrachtung im Voraus) an. Diese muss innerhalb eines gewissen Beurteilungsspielraums nachvollziehbar sein. Nachträgliche Erkenntnisse, die sich bei einer späteren Beurteilung ergeben, sind im Rahmen einer Rückschau (ex-post-Betrachtung) nicht zu berücksichtigen. Abzustellen ist regelmäßig auf die damalige Sicht eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters. Damit kann die Richtigkeit von Prognosen nicht nachträglich danach beurteilt werden, ob die prognostizierte Entwicklung tatsächlich eingetreten ist (sog. Rückschaufehler).
In der Praxis ist deshalb die Dokumentation der auf einer ex-ante-Basis getroffenen Beurteilung von besonderer Bedeutung. Sind die der Planung zugrunde gelegten Annahmen plausibel und ordnungsgemäß dokumentiert, ist der Planersteller bei einer späteren Diskussion hierüber aufgrund seines Beurteilungsspielraums wegen der bei Planungen vorherrschenden Unsicherheit gut gerüstet. Gleiches gilt im Übrigen nicht nur für die insolvenzrechtliche Fortbestehensprognose, sondern beispielsweise auch für die Beurteilung eines Haftungstatbestands nach § 15b InsO.
Liquiditätsplanung auch zur eigenen Sicherheit aufstellen
Geschäftsleitern von KMUs, die bislang noch keine Liquiditätsplanung in den Unternehmen etabliert haben, wird nicht nur vor dem Hintergrund der daraus resultierenden Haftungsfolgen, sondern im ureigensten Interesse der Sicherung des Fortbestands ihres Unternehmens dringend angeraten, dies, ggf. unter Zuhilfenahme externer Experten, nachzuholen. Welche Anforderungen an die Planung zu stellen sind, kann auch dem in der aktuellen Ausgabe 02/22 der KSI veröffentlichten Beitrag „Die Unternehmensplanung im Spannungsfeld von Krisenfrüherkennung und Krisenmanagement nach § 1 StaRUG“ von Steffan/Poppe/Roller entnommen werden, die das aus § 1 StaRUG erforderliche Zusammenspiel von Krisenfrüherkennung und Krisenmanagement mit der Unternehmensplanung beleuchten.