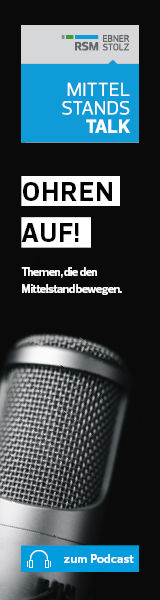Der Sachverhalt:
Die in einem Seniorenpflegeheim untergebrachte Beschwerdeführerin erteilte im Jahr 2000 eine notarielle General- und Vorsorgevollmacht an ihren Sohn, der ebenfalls Beschwerdeführer ist. Im Sommer 2012 erreichte sie die Pflegestufe III. Nachdem die Beschwerdeführerin mehrfach aus einem Stuhl oder ihrem Bett auf den Boden gefallen war und sich dabei Verletzungen zugezogen hatte, willigte ihr Sohn ein, Gitter an ihrem Bett zu befestigen und sie tagsüber mit einem Beckengurt im Rollstuhl zu fixieren.
Die Gründe:
Durch die fachgerichtlichen Entscheidungen, die die Genehmigung der Einwilligung in die freiheitsbeschränkenden Maßnahmen aussprechen, werden die beiden Beschwerdeführer nicht in ihren Grundrechten verletzt.
Die in § 1906 Abs. 5 BGB festgeschriebene Verpflichtung, vor zusätzlichen Freiheitsbeschränkungen trotz Einwilligung der Vorsorgebevollmächtigten eine gerichtliche Genehmigung der Einwilligung einzuholen, greift zwar in das Selbstbestimmungsrecht der Beschwerdeführerin aus Art. 2 Abs. 1 GG ein. Das Recht auf Selbstbestimmung wird jedoch nicht uneingeschränkt, sondern nur im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung gewährleistet. Bestandteil dieser verfassungsmäßigen Ordnung ist jede Rechtsnorm, die formell und materiell der Verfassung gemäß ist. Diese Voraussetzung erfüllt die angegriffene Vorschrift des § 1906 Abs. 5 BGB. Der Staat ist durch Art. 2 Abs. 2 S. 1 und S. 2 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 S. 2 GG verpflichtet, sich dort schützend und fördernd vor das Leben, die körperliche Unversehrtheit, die Freiheit und die sexuelle Selbstbestimmung des Einzelnen zu stellen und sie vor Eingriffen von Seiten Dritter zu bewahren, wo die Grundrechtsberechtigten selbst nicht (mehr) dazu in der Lage sind.
Es kommt insoweit auf den tatsächlichen, natürlichen Willen, nicht auf den Willen eines gesetzlichen Vertreters an; fehlende Einsichts- und Geschäftsfähigkeit lässt den Schutz nicht von vornherein entfallen. Vielmehr kann sich für Betroffene, denen die Notwendigkeit der Freiheitsbeschränkung nicht mehr näher gebracht werden kann, die durch Dritte vorgenommene Beschränkung als besonders bedrohlich darstellen. Dies wird in der konkreten Situation der Freiheitsbeschränkung nicht dadurch gemindert, dass die Betroffenen im zeitlichen Vorfeld zu einem Zeitpunkt umfassender Vernunft und Geschäftsfähigkeit vorgreiflich in derartige Beschränkungen eingewilligt oder erklärt haben, die Entscheidung über solche Beschränkungen in die alleinige Verantwortung bestimmter Vertrauenspersonen legen zu wollen.
Im Hinblick darauf, dass für die grundrechtliche Beurteilung der Schwere des Eingriffs auch das subjektive Empfinden von Bedeutung ist, macht es in diesem konkreten Fall für die Grundrechtsträgerin keinen Unterschied, ob ihr Fixierungen zur Beschränkung ihrer Bewegungsfreiheit aufgrund Veranlassung durch einen staatlich bestellten Betreuer oder den Vorsorgebevollmächtigten angelegt werden sollen. Es entspricht daher der Wahrnehmung staatlicher Schutzpflichten, wenn der Gesetzgeber in § 1906 Abs. 5 BGB die Einwilligung des Bevollmächtigten in derartige Freiheitsbeschränkungen unter ein gerichtliches Genehmigungserfordernis stellt. Der zugleich hierin liegende Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht der Betroffenen aus Art. 2 Abs. 1 GG ist im Hinblick auf diesen Schutz verhältnismäßig. Das Argument des Beschwerdeführers, die Neufassung des § 1904 Abs. 4 BGB für den Bereich ärztlicher Maßnahmen gebiete, erst recht bei dem weniger schweren Eingriff nach § 1906 Abs. 5 BGB auf das gerichtliche Genehmigungserfordernis zu verzichten, verkennt den unterschiedlichen Anwendungsbereich dieser Vorschriften.
Die nach § 1904 BGB vorzunehmenden Maßnahmen sollen dem Willen der Patienten entsprechen; erst soweit über dessen Inhalt keine Einigkeit erzielt werden kann, ist das Gericht einzuschalten. Demgegenüber soll im Rahmen von § 1906 BGB der jedenfalls noch vorhandene natürliche Wille der Betroffenen überwunden werden. Vor diesem Hintergrund ist die unterschiedliche Handhabung der Erforderlichkeit des gerichtlichen Genehmigungserfordernisses gerechtfertigt. Soweit die Verfassungsbeschwerde auf die Möglichkeit abstellt, einen Kontrollbetreuer zu bestellen, verkennt sie, dass dies nur einen nachträglichen Schutz gewähren würde. Die gegen den natürlichen Willen der Betroffenen vorzunehmende Freiheitsbeschränkung wäre keiner vorgreiflichen Kontrolle unterworfen, und bei einem im Nachhinein festgestellten Vollmachtsmissbrauch könnten die durchgeführten Maßnahmen nicht mehr rückgängig gemacht werden.
Linkhinweis:
- Der Volltext ist auf der Homepage des BVerfG veröffentlicht.
- Um direkt zum Volltext zu kommen, klicken Sie bitte hier.